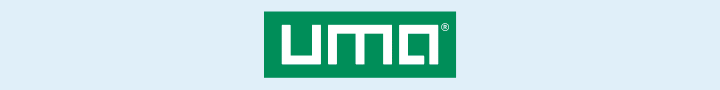Dass die Werbeartikelbranche preissensitiv ist, ist eine Binsenweisheit. In der schwierigen Marktumgebung des B2B-Marktes Preisgefüge profitabel zu halten, gehört zu den größten Herausforderungen, vor denen Lieferanten und Händler stehen. Doch auch Einkäufer zeigen bisweilen Gefühle, und selbst für hart umkämpfte Produktsegmente gibt es Spielraum in der Preisgestaltung.

Wenn Unternehmer vom Krieg sprechen, sprechen sie meist über Preise. Und selbst wer sich bei sonstigen Unternehmer-Lieblingsthemen wie Wachstum oder Innovation ganz selbstverständlich aufseiten der Gewinner verortet, nimmt beim Thema Preiskampf ebenso selbstverständlich die Opferrolle ein. Wie das so ist mit Kriegen: Angefangen haben immer die anderen. Die Global Pricing Study 2017 der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners, einer der weltweit renommiertesten Pricing-Agenturen, die Kunden aus vielfältigen Branchen bei Preisfindungsprozessen berät, belegt dieses Phänomen sogar empirisch: Fast 70% der Befragten waren der Ansicht, es gebe in ihrer Branche einen Preiskrieg – und 77% davon sagen, ein Wettbewerber habe diesen begonnen. Ausgewertet wurden Antworten von 1.925 Unternehmen aus mehr als 40 Ländern weltweit. Wichtigster Treiber des zunehmenden Preisdrucks, so 75% der Befragten, ist die Digitalisierung.
Es stimmt: E-Commerce hat die Dynamik des Marktes radikal verändert. Das Internet führt zu knallharter Vergleichbarkeit, Bezugsquellen liegen offen. Das zeitigt auch – und gerade – im Werbeartikelmarkt massive Auswirkungen. Mit harten Bandagen gekämpft wird hier allerdings nicht erst im Zuge der Digitalisierung. Seit jeher funktioniert der B2B-Markt nach eigenen Regeln, die jeder verstehen und beherzigen muss, der hier bestehen will. „Die Zielgruppe in B2B-Branchen ist signifikant kleiner als in Consumerbranchen, und die Kaufprozesse, d.h. wo und wie gekauft wird, unterscheiden sich stark von denen im Retail“, erklärt Björn Dahmen, Partner in der Global Consumer & Retail Practice bei Simon-Kucher in Köln. „Die Einkäufer im B2B sind professionell, die Procurement-Prozesse mehr oder weniger definiert, es gibt wenig bis keine Spontankäufe. Zwar gibt es auch unter Werbeartikeleinkäufern eine gewisse Habitualisierung à la: ‚Das haben wir immer so gemacht‘. Zudem wird häufig wiederbevorratet. Wer Werbeartikel verkauft, sollte sich jedoch fragen, wie weit diese Habitualisierung reicht – denn wenn neue Projekte anstehen, man mal ein anderes Produkt ausprobieren will oder eben die Preise nicht stimmen, wird ganz schnell gewechselt.“

Der Retail beeinflusst nicht nur die Trends und Innovationen im B2B-Markt, sondern z.T. auch die Preisvorstellungen. Markenhersteller, die ihre Produkte im Werbeartikelmarkt verkaufen, können davon profitieren.
„Wenn ich privat einkaufe, ein Produkt sehe und in Stimmung bin, dann kaufe ich es und vergleiche nicht vorher noch Preise“, meint Kai Gminder, Geschäftsführer des Textilspezialisten Gustav Daiber. „Das ist im B2B fundamental anders, hier gibt es immer einen Vergleich. Die Kunden sind genau informiert und wissen ganz genau, was wo wieviel kostet, deshalb wird um jeden Cent gefeilscht, und im Zweifel wird ein Alternativprodukt angeboten, oder man geht zum Wettbewerber. Ein Wiederverkäufer im B2B-Bereich fällt Entscheidungen nicht direkt für sich, sondern für seinen Kunden – da ist nur wenig Emotion im Spiel. Läuft ein neues Produkt nicht richtig an, kann das auch am Preis liegen.“
Nun gehört es zum kleinen betriebswirtschaftlichen Einmaleins, möglichst kosteneffizient einzukaufen – doch bleibt den Importeuren in der Werbeartikelbranche auch im Sourcing nur wenig Spielraum. „Das Aldi-Modell hat deshalb lange Zeit so gut funktioniert, weil der Pionier im Discounter-Markt z.T. Kostenvorteile im Einkauf und v.a. absolute Effizienz in allen vor- und nachgelagerten Prozessen hatte“, so Dahmen. „In der Werbeartikelbranche gibt es kein Aldi-Prinzip, weil alle die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Bezugsquellen haben, was komparative Kostenvorteile erschwert. Eine Chance besteht in der operationellen Exzellenz.“ Erst recht in Zeiten, da Produktsicherheit und ethisch einwandfreie Lieferketten zu den Geboten der Stunde gehören: „Das Internet und die Online-Plattformen bringen zwar eine Preistransparenz mit sich, die die Preisvorstellungen maßgeblich beeinflusst“, so Marcus Sperber, Geschäftsführer von elasto. „Viele Faktoren, wie z.B. das Thema Produktsicherheit, sind jedoch darin gar nicht ersichtlich.“ Als wäre das nicht genug, kommen in vielen europäischen Märkten steuerliche Wertgrenzen hinzu, die jeder Werbeartikelplayer, dessen Portfolio sich in relevanten Preissegmenten bewegt, mit in seine Kalkulation einbeziehen muss: „Wir sind bestrebt, unseren Kunden attraktive Sortimente innerhalb der Richtlinien zur Verfügung zu stellen“, bestätigt Yves Dähler, Head of Corporate Business bei Victorinox. „Doch Produkte mit z.T. lebenslanger Garantie kann man leider nicht für jeden Preis herstellen. Zudem stehen wir zu einer nachhaltigen und lokalen Produktion. Diesbezüglich kennen wir keine Kompromisse und lassen uns auch nicht in ein Preiskorsett zwängen. Steuergrenzen bürden den Unternehmen einen enormen bürokratischen Akt auf, fördern den Import von Billigware und entziehen den lokalen Herstellern den Nährboden.“
All das führt dazu, dass die Margen bei allen Marktteilnehmern unter Druck stehen – Druck, der entlang der Wertschöpfungskette weitergegeben wird. Dähler: „Preise von Markenprodukten werden oft dazu missbraucht, um sich als günstigster Händler zu profilieren. Deswegen klagen viele Partner über sehr kleine Margen. Diese Margen bestimmen jedoch nicht wir Hersteller, sondern die Werbeartikelhändler in ihrem Wettbewerb.“
Mondpreise vs. UVP
Anders als im Retail gibt es im Werbeartikelmarkt keine Unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Das bietet den Wiederverkäufern einen gewissen Spielraum, beraubt die Hersteller und Importeure jedoch eines wichtigen Steuerungsinstruments. „UVPs sind häufig die einzige Möglichkeit für Hersteller, zu kommunizieren, welchen Wert sie einem Produkt beimessen“, so Dahmen. „Als Wertanker sind und bleiben sie eine gute Sache.“ Eine Hilfskonstruktion ist der Industriepreis, den viele Lieferanten heutzutage ausweisen, und der eine gewisse Orientierung bietet. Manche Lieferanten gehen sogar noch weiter: „Früher haben Händler auf Verkaufsplattformen z.T. Mondpreise für unsere Produkte verlangt“, so Gminder. „Um dagegen anzugehen, haben wir einen echten Endkundenpreis eingeführt, der nochmal deutlich über dem Industriepreis liegt. Der Handel kann weiterhin entscheiden, wie hoch er seinen Aufschlag gestalten möchte – ob er Gewinnmaximierung betreiben oder seinen Kunden mit günstigen Preisen, die unter dem Endkundenpreis liegen, an sich binden möchten.“ Dähler ergänzt: „Wir spielen mit offenen Karten und stellen fest, dass eine klare und einheitliche Preispolitik auch den Wiederverkäufern Sicherheit gibt und sie Spaß haben, unsere Produkte zu verkaufen.“ Dabei profitieren Markenhersteller und ihre Handelspartner natürlich stark vom Image der Marke. Die am Retail orientierte Preisvorstellung der Empfänger liegt meist erheblich über den Handels- und Industriepreisen, was Markenartikel gegenüber Importware attraktiv macht. „Sind wir mit einem Artikel im Retail erfolgreich, lässt sich dieser Erfolg grundsätzlich auch im B2B-Geschäft multiplizieren“, bestätigt Dähler.
Wer macht die Preise?
Nun haben die meisten Unternehmen im Markt für haptische Werbung nicht den Luxus einer „Schaufenster-Visibilität“ im B2C, sondern müssen ihr Pricing allein mit Blick auf den eigenen Markt gestalten. In der Werbeartikelbranche, die von kleinen bis mittelständischen Unternehmen dominiert wird, ist die Preisfindung meist Chefsache: „Wir machen unsere Preise ausschließlich intern“, so Sperber, „dabei arbeitet die Geschäftsleitung mit dem Produktmanagement zusammen.“ Gminder bestätigt und ergänzt: „Nur ein kleiner Kreis aus Geschäftsführung und Einkauf ist in den Prozess der Preisgestaltung involviert – anders würde das nicht funktionieren.“ Dahmen rät ganz unabhängig von der Unternehmensgröße den Chefetagen, sich in Pricing-Prozesse zumindest einzumischen: „Die Top-Ebene sollte immer ein Wörtchen mitreden. Natürlich muss ein Vorstand nicht die Preise festsetzen, absegnen sollte er sie trotzdem. Das signalisiert den Mitarbeitern: Unsere Pricing-Strategie wird wertgeschätzt, und die Führung interessiert sich nicht nur für Umsätze und Gewinne. Das gilt für Konzerne ebenso wie für 20-köpfige Unternehmen. Preislisten werden i.d.R. zweimal im Jahr neu erstellt. Warum sollten die Führungsebenen sich da heraushalten?“

Chefetage, Einkauf oder Vertrieb? Die Frage, wer am Pricing-Prozess beteiligt sein sollte, ist strategischer Natur.
How much is enough?
Viel wichtiger noch als die Frage, wo man den Pricingprozess unternehmensintern positioniert, ist die richtige Pricingstrategie. Vereinfacht ausgedrückt, gibt es drei verschiedene Ansätze für die Preisfindung. Der erste ist kostenbasiert: Auf den Einkaufspreis oder die Produktionskosten plus die sonstigen laufenden Kosten, die ein Produkt in sich trägt, wird eine Summe x geschlagen – die erwartete Gewinnspanne plus Spielraum für Skonto und eventuelle Rabatte. Ansatz Nr. 2 – das sogenannte Pricematching – orientiert sich am Markt bzw. an den Preisen des Wettbewerbs. Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Preis wertbasiert zu ermitteln, wie Dahmen erklärt: „Man sollte sich immer fragen: Was ist mein Produkt wert, d.h., was ist die Zielgruppe bereit, zu zahlen? Wir raten grundsätzlich dazu, ein Pricing wertbasiert auszurichten. Rein kosten- und wettbewerbsorientierte Preisstrategien tragen entscheidende Nachteile in sich und führen nicht zu Gewinnmaximierung – diese Grundregel gilt für alle Handelsbranchen.“
Meist wenden Unternehmen daher eine Mischung aus allen drei Preisstrategien an. „Grundsätzlich gilt: Der Deckungsbetrag muss passen, und wir müssen safe sein, was unsere Marge angeht, deshalb kalkulieren wir immer ein Stück nach oben“, erklärt Gminder. „Vor diesem Hintergrund ergibt sich der Preis immer aus dem Einkauf. Ihn rein vertrieblich festzulegen, wäre der falsche Ansatz.“ Das bedeutet keinesfalls, dass Daiber sein Pricing rein kostenorientiert vornimmt – im Gegenteil: „Die Frage, wieviel ein Kunde bereit ist, zu zahlen, ist betriebswirtschaftlich essenziell, und deshalb spielt das Feedback des Vertriebs eine wichtige Rolle“, so Gminder. „Wichtig ist: Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss passen. Wir erhalten viel Feedback vom Außendienst zu unseren Produkten, wenn z.B. ein Kunde die Rückmeldung gegeben hat, dass ein bestimmtes Produkt in eine bestimmte Preiskategorie passen muss. In diesem Fall gestalten wir das Produkt dann weniger aufwendig – lassen z.B. eine Tasche weg.“
Dahmen: „Es gibt zwei grundsätzliche Pricing-Fehler, die überall vorkommen, selbst in Riesenunternehmen: Entweder der Preis ist zu hoch angesetzt – das ist nicht schön, hat aber den Vorteil, dass es relativ schnell bemerkt wird. Ein zu niedriger Preis ist viel gefährlicher, weil sich Unternehmen auch noch für ihre Riesenumsätze feiern, ohne zu hinterfragen, ob der Gewinn nicht viel höher hätte ausfallen können. Wir sind dann die ‚Spielverderber‘, die bei den Unternehmen nachfragen, ob sie sicher sind, dass sie ihr Produkt nicht zu billig gemacht haben. Wenn ich einen Preis rein kostenbasiert setze, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich einen solchen Fehler mache und in der Folge immer mehr verkaufen muss, um meinen Gewinn zu sichern.“ Wer sich ausschließlich am Wettbewerb orientiert, landet schnell in den Preiskriegen, die niemand braucht und niemand angefangen haben will. „Geheime Preisabsprachen, die Preise künstlich hochhalten, sind zu Recht illegal und werden mit hohen Strafen geahndet. Deshalb ist Fingerspitzengefühl gefragt. Jeder Marktteilnehmer sollte den Markt genau im Auge behalten und die mögliche Reaktion seiner Mitbewerber auf eine Preisabsenkung bedenken“, erklärt Dahmen. „Wenn Hunderte von Unternehmen ein Massenprodukt wie z.B. einen Fidget-Spinner anbieten, kann jeder einzelne das Produkt 5 Cent billiger machen, und die anderen müssen nachziehen. Am Ende haben alle verloren.“
Differenzieren bitte!
Während es Produkte gibt, die zwingend knapp kalkuliert werden müssen und sich im Pricing stark an den Einkaufs- und Produktionskosten und dem Preisgefüge im Markt orientieren, gibt es anderswo mehr Spielraum. „Made in Germany-Produktionen können wir zu Großteilen auftragsbezogen fertigen und dadurch anders kalkulieren als Ware, die längerfristig eingelagert wird“, erklärt Sperber. „Bei jedem Artikel müssen wir diverse Faktoren wie Lizenzen, Abgaben etc. einbeziehen. Es ist daher unumgänglich, jedes Produkt als einzelnes zu betrachten und individuell zu bewerten.“ Experten wie Dahmen raten dringend dazu, Portfolios auszudifferenzieren und je nach Produktsegment unterschiedliche Pricing-Strategien zu implementieren. „Natürlich kann ich bei vielen Tausenden Artikeln mit etlichen Langsamdrehern nicht für jedes Produkt einen individuellen Preis machen. Aber ich kann Strukturen schaffen, mir überlegen, welcher Artikel wofür steht und die Margen auch mal variieren. Ganz wichtig sind die Frequenztreiber, denn sie stabilisieren nicht nur das Geschäft, sondern ziehen auch die Kunden an. Solche Top-Artikel muss ich aggressiv bepreisen. Dafür habe ich in anderen Bereichen, wie z.B. Sonderanfertigungen, ganz andere Möglichkeiten.“
Das Gleiche gilt für Produkte, die sich vom Massenmarkt abheben – etwa durch eigene Designs oder innovative Funktionen. „Design ist ein klarer Werttreiber“, so Dahmen. „Wer sich dabei an modischen Strömungen orientiert, kann zusätzliche Kaufimpulse auslösen, wobei diese natürlich saisonal limitiert sind. Hier gilt es ebenso aufzupassen wie in Bezug auf zu gewagte Gestaltungsexperimente.“ Für alle Features und Distinktionsmerkmale – ob gestalterischer oder funktionaler Natur – gilt: Sie müssen kritisch hinterfragt werden, und zwar aus Kundensicht. „Was kein Mensch braucht, zahlt auch kein Mensch“, so Dahmen weiter. „Es gibt in vielen Märkten Produkte, die ‚over-engineered‘ sind. Jedes Feature muss für den Kunden einen Wert haben und Zahlungsbereitschaft auslösen.“
Wie solche sinnvollen Features im Textilmarkt aussehen können, veranschaulicht Gminder: „T-Shirts mit Swarowski-Steinen sind für uns nicht zielführend. Stattdessen gehen wir in die Breite, gehörten z.B. zu den ersten im Markt, die Damenschnitte und eine größere Farbpalette als die üblichen fünf bis sechs Farbstellungen angeboten haben. Seltene Farben sind keine Umsatztreiber, aber sie laufen saisonal gut. Das Gleiche gilt für Innovationen wie die coldblack-Textilien, die sich in der Sonne nicht aufheizen. Solche Features erzählen Geschichten und helfen, im Gespräch zu bleiben, sodass der Kunde sagt: ‚Wenn die das können, dann können sie auch normale T-Shirts.‘“
Der berühmte Mehrwert

Design als Werttreiber: Eigene Produkte, die sich vom Massenmarkt abheben, bieten mehr Spielraum in der Preisgestaltung.
Wer einmal eine Preisstruktur aufgestellt hat, darf sich nicht jahrelang darauf verlassen, sondern muss der Dynamik des Marktes Rechnung tragen. Es reicht nicht, die Preislisten zweimal im Jahr mit Blick auf gestiegene Fracht- oder Produktionskosten zu aktualisieren. „Wir sind ständigen Veränderungen ausgesetzt“, bestätigt Sperber. „Wichtig ist, die Preistransparenz im Kopf zu behalten und ständig an die Marktgegebenheiten anzupassen.“ Dahmen empfiehlt deshalb ein umfassendes Monitoring der Verkaufsprozesse: „Es gilt, ein Regelwerk zu bilden, damit kein Preis mehr zufällig passieren kann, und Fehler bei der Staffelung und beim Aufschlagsfaktor zu identifizieren. Preislisten sollten nicht nur in Word und Excel stehen, sondern in die ERP übernommen und immer wieder abgeglichen werden. Auf diese Weise kann man die Performance eines Produkts in dessen Wertdefinition mit einfließen. Je mehr Transaktionen ich nachverfolgen kann, desto mehr lerne ich daraus und kann z.B. die Frage ableiten, wann ich Rabatte oder Skonto gebe.“
Je ausgereifter ein solches Monitoring ist, desto besser lassen sich auch Faktoren mit einbeziehen, die zwar schwierig in Zahlen darstellbar, für ein wertbasiertes Pricing aber entscheidend sind, weil sie den vielzitierten Mehrwert für den Kunden schaffen – Faktoren wie Zuverlässigkeit, Service, Beratung, Lieferzeiten oder Flexibilität. „Sogar in Commodity-Märkten, die sehr stark standardisiert sind, gibt es Differenzierungen zwischen den Anbietern“, so Dahmen. „Selbst wenn die Tonne Zement überall das gleiche kostet, unterscheiden sich die Gesamtpakete erheblich voneinander – z.B., was den Service angeht. Kurz: Leistung hat Differenzierungscharakter.“ Leider lassen sich Serviceleistungen nur bis zu einem gewissen Grad im Preis abbilden. „Viele meiner Klienten klagen darüber, dass ihre Kunden Service zwar lieben, aber nicht bereit sind, dafür zu zahlen“, so Dahmen. „Der Kunde darf jedoch wissen, dass ich kein Billigheimer bin, und was er von mir im Vergleich zu anderen bekommt. Die daraus resultierende Loyalität rechnet sich dann wiederum doch irgendwo.“
Auch das Marketing zählt zu den Posten, die sich nur schwer im Produktpreis abbilden lassen. Wie Gminder erläutert, investiert sein Unternehmen massiv in hochwertige Marketingmaßnahmen, „ob Kataloge, die wir sehr aufwendig produzieren – u.a. mit professionellen Models und Fotografen sowie Fotoshootings an attraktiven Locations –, Filme oder Social Media. So etwas macht unsere Produkte und Marken erlebbar. Ich kann jedoch nur schwer messen, wie stark sich der Invest auf die Umsätze auswirkt. Wie dem auch sei – es wäre ein Fehler, die Kosten für Marketing zu 100% einzupreisen.“ Eine gewisse Vorleistung ist also notwendig, wird jedoch im Idealfall mit Loyalität belohnt, die im rauen Klima des B2B-Marktes ein wertvolles Gut ist – nicht zuletzt, weil sie das Klein-Klein um den letzten, den besten Preis hinter sich lässt. Langjähriger Erfolg jedenfalls gründet nur in seltenen Fällen auf penetranter Billigheimerattitüde. „Garantieversprechen, gute Dienstleistungen, Kulanz, Bescheidenheit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit …: Wir wissen, dass wir auch ohne einen ‚20% Rabatt‘-Aufkleber ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis ausweisen“, so Dähler. „Wir haben Kunden, die seit bald 100 Jahren Victorinox-Produkte sehr erfolgreich als Kundenbindungsmittel einsetzen. Wir Mitarbeiter machen den Job nicht nur, um unsere Rechnungen zu bezahlen. Diese Leidenschaft spüren unsere Kunden.“
Plötzlich sind dann selbst im knallharten Wettbewerb des Werbeartikelmarkts Gefühle im Spiel, und es wird nicht über drei Stellen nach dem Komma, sondern über Wert gesprochen. Wer das tut, ist übrigens nicht in der Opferrolle, sondern steht auf der Gewinnerseite.
// Till Barth
Illustration: Jens C. Friedrich, Beke Milas, © WA Media; Bildquelle: Shutterstock.com (3)